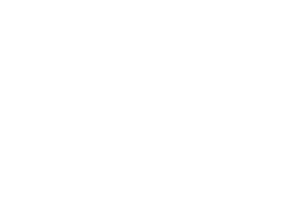Der Gerichts- und Fronweg
Der Fronhof
"Fro", althochdeutsch, heißt der "Herr", fronen ist also Arbeit für den Herrn.
Der Fronhof ist ein in Eigenwirtschaft eines Herrn stehender agrarischer Betrieb, dem auchländliche Handwerker zugeordnet sein konnten. Fronhöfe waren vielfach Mittelpunkt von Villikationen. Solchen Fronhofverbänden waren nach Leiherecht ausgegebene, mehr oder wenigerselbständige Bauernwirtschaften zugeordnet. Deren Inhaber mussten zum Fronhof Dienste leisten (Scharwerk). Die bereits in merowingisch-karolingischer Zeit belegten Fronhöfe des Königtumsund des Adels entwickelten sich vom 12. Jh. an zu Zentren der ostdeutschen Gutsherrschaft, wenn die Eigenwirtschaft intensiviert wurde, was vielfach in den Siedlungsgebieten der Fall war.
Zum Fronen mussten die Bauern der Grundherrschaft Wiesenburg auf die Wiesenburg.
Die Gerichtsbarkeit
In der außerordentlich vielschichtigen und vielfältigen Entwicklungsgeschichte der mittelalterlichen Gerichtsbarkeit gibt es eine Konstante: die Beendigung von Streitigkeiten zwischen verschiedenen Personen durch Urteil oder Beschluss eines Gerichts. Dies hat nur dann rechtliche,soziale und wirtschaftliche Bedeutung, wenn die rechtsprechende Instanz durch die Autorität und das Ansehen einer Gerichtsherrschaft legitimiert ist. Innerhalb des Personenverbandes musste Übereinstimmung darüber bestehen, dass der gerichtliche Spruch Achtung und Beachtung verdient. Dem stand nicht entgegen, ob diese Ein- und Unterordnung auf freiwillige Weise oder auch durch herrschaftlichen Zwang zustande gekommen war.
Daraus ergibt sich im langen Zeitraum der hoch- und spätmittelalterlichen Geschichte eine außerordentliche Vielfalt von Gerichtszuständigkeiten in persönlicher, örtlicher und sachlicher Hinsicht. Diese veränderten sich im Laufe der Entwicklung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse vom frühen 10. bis zum späten 15. Jahrhundert stark.
Die Bewohner der Herrschaft Wiesenburg gingen nach der Wiesenburg zu Gericht.
Der Fron- und Gerichtsweg wird sich in drei Abschnitte gliedern:
1. Abschnitt
von Bärenwalde bis zur Einmündung des Weges von Hartmannsdorf kommend. Wolfgang Fankhänel in seinen Recherchen zum "Frühbusser Steig" unter anderem:
"Der Übergang über die Mulde befindet sich im Bereich der jetzigen Talsperre Eibenstock und steht unter Wasser. Es führt noch die ehemalige Straße bis ans Ufer. Stark ausgefahrene Hohlwege am Nordufer bestätigen den Verlauf dieser Trasse. Von diesem Ufer aus ist auf den sächsischen Meilenblättern diese Straße über die Ortschaft Hundshübel, das Geleithaus, den Schirrberg, die Ortschaft Lichtenau bis Bärenwalde zu verfolgen. 'Schirrberg'; und 'Geleitshaus'; weisen auf Fuhrwerksverkehr und eine Geleitsstraße hin, die den Verlauf zumindest in das 13. Jahrhundert datieren lässt."
2. Abschnitt
von Hartmannsdorf bis zur Gerichtseiche, Station 10 des Natur- und Bergbaulehrpfades,
3. Abschnitt
von Saupersdorf bis in den "Hohen Forst" (alte Wiesenburger Landstraße)
4. Abschnitt
vom "Hohen Forst" bis an die Mulde. Siehe dazu Wanderweg "Über Herrschaftsgrenzen hinweg".
Der Weg Abschnitt 1,2 und 3 ist geplant, wird bei Bereitstellung von Fördermitteln realisiert und ist Bestandteil des zukünftigen Quaalitätswanderweges unter Anbindung der bereits bestehenden Kommunalen Wanderwegen. Realisierungszeitraum 2016.